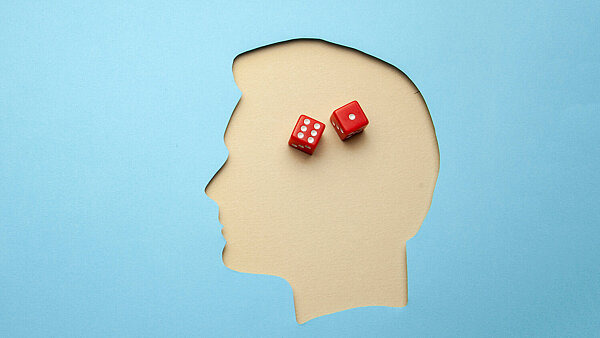Der Battle-Pass verspricht exklusive Items. Im Livestream auf Twitch ruft der Chat „!gewinn“. Bei GTA Online wartet das virtuelle Casino mitten im Spiel.
Was all diese Dinge gemeinsam haben? Sie zeigen, wie sich Glücksspiel-Elemente immer mehr in andere Lebensbereiche schleichen.
Für diese Entwicklung gibt es inzwischen einen Begriff: Gamblification.
Was bedeutet Gamblification?
Gamblification beschreibt die zunehmende Präsenz von Glücksspiel oder glücksspielartigen Elementen in Kontexten, die auf den ersten Blick nichts mit Glücksspiel zu tun haben. Das betrifft zum Beispiel Spiele, Apps oder soziale Netzwerke.
Doch wo verläuft die Grenze? Und wie lässt sich das erkennen? Dafür ist es entscheidend, erstmal zu definieren, was „Glücksspiel” im Kern eigentlich ausmacht.
Ab wann spricht man von „Glücksspiel”?
Eine genaue Definition dafür zu finden ist nicht ganz einfach.
Klassischerweise spricht man aber von Glücksspiel, wenn folgende 3 Merkmale gegeben sind:
- Einsatz: Man setzt etwas ein, das einen Wert hat. Klassischerweise ist das Geld. Es kann aber auch etwas anderes sein. Wie zum Beispiel persönliche Daten.
- Chance: Der Ausgang ist ungewiss. Das heißt: Zufall spielt die entscheidende Rolle. Man weiß vorher nicht, ob man gewinnt oder nicht.
- Preis: Man kann etwas gewinnen. Meistens wieder Geld. Oder Dinge, die Geld wert sind (z. B. Skins, Gutscheine, virtuelle Münzen).
Nur wenn alle drei Merkmale erfüllt sind, spricht man im klassischen Sinne von Glücksspiel. Aber in der Praxis ist das häufig schwer zu bewerten, ob ein solches Merkmal vorliegt oder nicht.
Warum tauchen Glücksspielelemente immer öfter in Games oder Apps auf?
Dafür gibt es einfache Gründe: Viele Anbieter bauen solche Elemente ein, weil sie sich Vorteile davon versprechen. Zum Beispiel:
- Nutzer:innen immer stärker zu binden, sodass sie länger dranbleiben
- Nutzer:innen zu motivieren
- Nutzer:innen zur Kasse zu bitten
Unterschiedlich stark: wie viel Glücksspiel steckt drin?
In vielen Fällen werden echte Glücksspielmechaniken eingebaut. Mit allen typischen Bestandteilen: Einsatz, Zufall und Gewinn. Das ist zum Beispiel bei echten Verlosungen, Wetten oder Giveaways auf Twitch der Fall.
Daneben gibt es aber oft auch abgeschwächte Formen: Zum Beispiel bei Mystery-Boxen, bei denen man bezahlt, aber vorher nicht weiß, was man bekommt. Oder bei sogenannten Social Casino Games, in denen mit Spielgeld gespielt wird, das man sich aber oft erst kaufen muss.
Faktencheck: Sind Loot-Boxen eigentlich Glücksspiel?
Lootboxen sind Kisten oder Pakete in Videospielen, die zufällige Belohnungen enthalten. Zum Beispiel besondere Skins, Ausrüstung oder andere Extras. Manche kann man kostenlos öffnen, andere kosten Geld.
Viele Studien zeigen: Lootboxen ähneln klassischem Glücksspiel, weil sie oft die typischen Glücksspiel-Merkmale enthalten. Aber: Nicht alle Lootboxen funktionieren gleich. Manche Systeme erinnern stärker, andere weniger stark an Glücksspiele. Viele enthalten aber Mechaniken, die typische Glücksspielelemente nachahmen.
In einigen Ländern gelten Lootboxen deshalb juristisch bereits als Glücksspiel. In Deutschland ist das noch nicht eindeutig geregelt. Es gibt bisher kein Gerichtsurteil, das Lootboxen offiziell als Glücksspiel einstuft (Stand: Juli 2025).
Was sind die Risiken von Gamblification?
1. Besonders riskant für Kinder, Jugendliche und Suchtgefährdete:
Viele Inhalte mit Glücksspiellogik sind nicht klar als solche erkennbar. Sie wirken wie ganz normale Spiel-Features und tauchen oft unerwartet auf.
Gerade für junge Menschen kann das gefährlich sein. Denn: Wer schon früh an solche Mechaniken gewöhnt wird, entwickelt schneller riskante Spielmuster.
2. Glücksspiel wird “normal”:
Wenn Glücksspielfunktionen plötzlich Teil von Alltags-Apps oder Games sind, verschwimmt die Grenze. Was früher klar Glücksspiel war, fühlt sich heute wie ein ganz normales Spielelement an. Das Risiko: Die Gefahren von Glücksspiel werden dadurch unterschätzt.
3. Verstärkte Nutzung von Glücksspiel:
Studien zeigen Hinweise darauf, dass Menschen, die viel Social Casino Games spielen, später eher auch mit echtem Geld im Online-Casino landen. Der Übergang ist meist fließend.
4. Täuschende Gewinnchancen und fehlende Transparenz:
Oft ist nicht klar, wie hoch die Chance auf einen Gewinn wirklich ist. Die Wahrscheinlichkeiten stehen häufig im Kleingedruckten. So wirken Social Casino Games auf den ersten Blick meist wie harmlose Übungsspiele, nutzen aber oft unrealistische Gewinnchancen. Das führt zu einem falschen Gefühl von Kontrolle oder „Können“, das sich beim Wechsel zu echtem Glücksspiel nicht bestätigt.
5. Datenschutz:
Viele dieser Angebote wirken kostenlos – aber bezahlt wird trotzdem: mit persönlichen Daten. Oft ist den Nutzer:innen gar nicht bewusst, dass ihre Daten der eigentliche Einsatz sind. Zum Beispiel bei der Teilnahme an Gewinnspielen, bei der Anmeldung oder durch das Tracking im Hintergrund.
Die Grenze von Glücksspiel und anderen digitalen Aktivitäten wird immer unschärfer
Was hat inzwischen alles „Wert“ im Netz? Zum Teil ist es Geld. Aber oft auch Likes, virtuelle Gegenstände, soziale Anerkennung oder sogar persönlichen Daten.
Wenn solche Dinge als Einsatz gelten, wird es immer schwieriger zu sagen, ab wann man von Glücksspiel sprechen kann. Die Grenzen werden immer unschärfer.
Vielleicht erleben wir in Zukunft noch ganz neue Formen von Glücksspiel, die in digitalen Angeboten versteckt sind, die auf den ersten Blick gar nichts mit Glücksspiel zu tun haben.
Quellen:
- Abarbanel B (2018) Gambling vs. gaming: a comment on the role of regulatory, industry, and community stakeholders in the loot box debate. Gaming Law Review 22(4): 231–234. https://doi.org/10.1089/glr2.2018.2243
- Abarbanel B and Rahman A (2015) eCommerce market convergence in action: social casinos and real money gambling. UNLV Gaming Research & Review Journal 19(1): 51–62. https://doi.org/10.9741/2327-8455.1319
- Kao D (2020) Infinite loot box: a platform for simulating video game loot boxes. IEEE Transactions on Games 12(2): 219–224. https://doi.org/10.1109/TG.2019.2913320
- Macey, J., & Hamari, J. (2024). Gamblification: A definition. new media & society, 26(4), 2046-2065. https://doi.org/10.1177/14614448221083903
- Reith G (2018) Addictive Consumption: Capitalism, Modernity and Excess. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429464447
- Zendle D, Cairns P, Barnett H, et al. (2020) Paying for loot boxes is linked to problem gambling, regardless of specific features like cash-out and pay-to-win. Computers in Human Behavior 102: 181–191. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.07.003